In der Winterzeit im Gartenpark zu entdecken

Stellenausschreibung
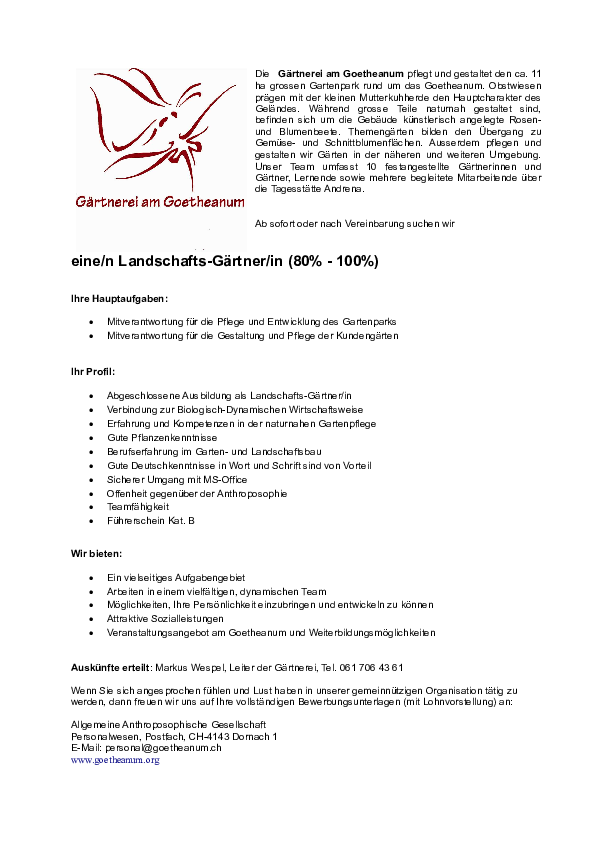
Freiwillge Hilfe im Naturschutzgebiet

Blühende Staudenbeete im Sommer


Schönheit, Biodiversität und Pflege im Einklang
In einem gut angelegten Staudenbeet ist das Ziel, eine vielfältige Pflanzengemeinschaft zu fördern, die sowohl optisch als auch ökologisch überzeugt. Hinter der scheinbar wilden Schönheit eines blühenden Staudenbeets steckt viel Wissen, Pflege und ein sensibler Umgang mit Natur, Ästhetik und Ökologie.
Zwischen Wildheit und Gestaltung
Stauden sind mehrjährige, krautige Pflanzen, die sich im Winter in den Boden zurückziehen und im Frühjahr neu austreiben. Anders als einjährige Blumen entwickeln sie über die Jahre eine stabile, robuste Struktur. Die Pflege eines Staudenbeets ist ein Balanceakt zwischen Zurückhaltung und gezieltem Eingriff.
«Man gestaltet das Beet eigentlich durch Jäten. Das Spannende ist, dass ein Staudenbeet sich ständig verändert – durch Selbstversamung, durch die Pflege und durch äussere Einflüsse», erzählt Miranda Bossard, Gärtnerin und Landwirtin am Goetheanum. Es sei ein dynamischer Prozess, bei dem das Verhältnis von einzelnen Pflanzenarten immer wieder neu entstehe. Das bedeutet nicht nur Arbeit, sondern auch eine gewisse Verantwortung: Welche Arten sollen dominieren? Welche müssen gebremst werden? Und wie bleibt die Vielfalt erhalten, ohne dass einzelne Arten alles überwuchern?
Biodiversität versus Ästhetik?
Moderne Staudenpflege berücksichtigt zunehmend auch ökologische Aspekte: Totholz und verblühte Pflanzenstände sind wertvolle Lebensräume für Insekten, Vögel und andere Tiere. Doch gerade in öffentlichen Anlagen wie im Goetheanum Gartenpark ist der ästhetische Anspruch hoch. «Es ist ein Kompromiss. Für Insekten wäre es gut, alles liegen zu lassen. Für das Auge der Besucher:innen sieht das aber schnell nach Unordnung aus», betont Miranda.
Pflege im Rhythmus der Pflanzen
Schnittzeitpunkte spielen eine wichtige Rolle bei der Pflege: Manche Stauden können im Sommer nach dem ersten Flor zurückgeschnitten werden und treiben ein zweites Mal aus. Andere – wie Lavendel – bleiben vital, wenn sie regelmässig im Frühjahr und Herbst geschnitten werden. Es sei denn, man möchte, dass der Lavendel verholzt und seinen natürlichen Lebensweg geht. Dieser ist aber kürzer, als wenn man ihn regelmässig schneidet. Wann und wie oft eine Staude beschnitten wird, ist abhängig von der Frage: «Was will die Pflanze, was will der Mensch?», betont Hervé Haller, Staudengärtner am Goetheanum. «Wir wollen der Pflanze Zeit geben, ihren gesamten Entwicklungsprozess zu durchlaufen.»
Standort und Vielfalt
Nicht alle Staudenbeete sind gleich. Die Gestaltung hängt stark vom Standort ab. Im sogenannten Südbeet beispielsweise dominiert ein mediterranes Klima mit trockenen Bedingungen, während in nördlich gelegenen Beeten mehr Feuchtigkeit und schattige Lagen vorherrschen. Ganz besondere Voraussetzungen zeichnen die Innenhöfe des Goetheanum aus: schattig und zugleich trocken. Nur wenige Pflanzen mögen diese Kombination.
Ein weiterer Aspekt ist die Auswahl robuster Pflanzen für Wege oder Übergänge. «Es gibt Arten wie Habichtskraut, Günsel oder Thymian, die es sogar mögen, wenn wir über sie drüber laufen», sagt Miranda. Diese trittfesten Stauden stabilisieren nicht nur den Boden, sondern fügen sich auch harmonisch in das Gesamtbild ein. Manchmal ist nicht klar, wo ein Staudenbeet anfängt und der Durchgangsweg aufhört. Diese spannenden Übergänge gilt es beim Spazieren im Goetheanum-Gartenpark zu beachten.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Staudenbeete rund ums Goetheanum, die sowohl einheimische als auch südländische Pflanzen beinhalten. Auch verwilderte Bereiche haben ihren Platz – wie beim Südaufgang oder beim Studentenwohnheim, wo sich viele Pflanzen selbst ausgesät haben. Ein Beet, das wunderschön – wie ein Bächlein – angelegt ist, befindet sich oberhalb des Gemüsegartens und säumt den Spazierweg. Hier lohnt sich ein Sommerspaziergang – mit Blick über den Goetheanum-Gartenpark bis nach Basel!
Zukünftige Herausforderungen
Viele Beete existieren bereits seit Jahrzehnten. Mit der Zeit reichern sich Nährstoffe an; die ursprünglich mager gedachten Flächen verändern sich. Gleichzeitig machen sich invasive Arten wie Quecken breit, und es stellt sich die Frage: Soll man die Beete neu anlegen? «Es ist schade, weil dadurch ihr Charme verloren geht – aber irgendwann reicht Jäten nicht mehr», stellt Miranda fest. Es ist ein ständiges Abwägen zwischen Bewahren und Erneuern. Eine weitere Herausforderung ist, dass es immer mehr Möglichkeiten für neue Pflanzen wie Pistazien gäbe aufgrund der zunehmenden Erwärmung. Zugleich möchte man aber die einheimischen Pflanzen pflegen.
Ob mediterran, wildromantisch oder streng komponiert: Die Vielfalt ist riesig. Wer im Juli oder August über das Gelände spaziert, kann viel entdecken – und vielleicht auch mit neuen Augen sehen, was es heisst, ein Staudenbeet zu gestalten.
Faszinierende Rosenwelt am Goetheanum
Rosen sind seit jeher ein Sinnbild für Schönheit und Lebenskraft. Auch rund um das Goetheanum prägen sie die Landschaft und erfreuen Besucher:innen mit ihrer Vielfalt und Farbenpracht. Die Rosen am Goetheanum sind nicht nur eine Zierde, sondern finden auch Verwendung in der Floristik und zur Zubereitung von aromatischen Tees. In der Gärtnerei legen wir Wert auf ökologisch sinnvolle Sorten, und pflanzen daher weniger gefüllt blühende Sorten sondern eher botanische Rosen wie z.B. Rosa Gallica oder Wildformen.
Am Goetheanum begegnet man verschiedenen Rosenarten. Bodendecker- und Beetrosen blühen von Mitte Mai bis Ende Juli. Den grössten Bereich umfassen die Edelrosen. Mit über 20'000 bekannten Sorten bietet diese Gruppe eine enorme Vielfalt in Farbe und Form. Besonders eindrucksvoll sind die sogenannten Malerrosen, die mit grossen, gefüllten Blüten in intensiven Farbtönen faszinieren. Strauch- und Wildrosen, die sich durch Robustheit auszeichnen, findet man insbesondere am Südaufgang sowie in den Hecken auf dem Gelände. Eine Besonderheit ist die Rosa glauca (auch Lavendelrose genannt), die an ihren zart bläulichen Blättern erkennbar ist. Auch Kletter- und Ramblerrosen sind vertreten. Letztere wachsen höher als fünf Meter und sind bei der Halde und im Gedenkhain zu bewundern.
Die Pflege der Rosen folgt einem klaren Rhythmus. Sobald die starken Fröste vorbei sind, werden sie im Frühjahr zurückgeschnitten, um das Wachstum zu fördern. Ein weiterer Schnitt im Spätherbst schützt die Rosen vor Winterschäden. Manchmal werden sie zusätzlich während des Sommers geschnitten, um verblühte und kranke Triebe zu entfernen und so die Pflanzengesundheit zu fördern. Wichtig ist, die Rosen «luftig» zu schneiden, damit Krankheiten wie Pilzbefall vermieden werden und sie ihre volle Kraft entfalten können.
Die Welt der Rosen ist riesig. Fast alle Sorten – mit Ausnahme der Wild- und Strauchrosen – sind veredelt. Dabei wird häufig eine sogenannte Okulation, also eine Augenveredelung, vorgenommen. Vielleicht wird am Goetheanum zukünftig ein Workshop zu diesem spannenden Thema veranstaltet, denn Stecklinge lassen sich von fast jeder Rose ziehen.
Wer das Goetheanum besucht, sollte unbedingt einen Spaziergang im Gartenpark einplanen. Hier kann man nicht nur die Vielfalt und Schönheit der Königin der Blumen bewundern, sondern auch die Sorgfalt und Liebe spüren, mit der sie gepflegt wird.

Präparate Mitmach-Tag
Wir machen an unserem neuen Präparate Pavillon einen Aktionstag.
Die Hörner mit dem Hornmist kommen aus der Erde.
Wir treffen uns am Dienstag, 13.05.2025 um 15 Uhr am Präparate Pavillon.
Keine Anmeldung erforderlich.
Unsere Kühe sind wieder da!
Im Frühling kehren die Kühe zurück aus ihrem Winteraufenthalt auf unserem Partner-Hof «Untere Tüfleten» von Ursula Kradolfer und Felix Gebhardt. Die drei prächtigen Muttertiere mit ihren Kälbern des letzten Jahres freuen sich über das frische Gras. Alle Tiere sind hier geboren und somit Teil der Individualität des Goetheanum Gartenparks.
Das Besondere an der kleinen Herde ist, dass die Kälber jeweils zwei Jahre bei ihren Müttern bleiben. Das heisst, wenn im Herbst die neuen Kälber geboren werden, sind die letztjährigen noch da. Paul Pieterse, der Betreuer unserer Kühe, betont: «Es ist interessant zu beobachten, wie sich das Verhalten der älteren Kälber verändert, wenn ihre kleinen Geschwister zur Welt kommen. Eigentlich sind sie wie Teenager; sie tollen herum und machen Blödsinn. Nach der Geburt ihrer Geschwister werden sie ruhiger und übernehmen Verantwortung. Beispielsweise gehen sie mit ihren Geschwistern spazieren, sodass sich die Mutterkühe ausruhen können. Ein familiäres Verhältnis entsteht.»
Uns ist es wichtig, dass die Tiere sich frei entwickeln und ihren Haupttätigkeiten, Grasen und Wiederkäuen, ungestört nachgehen können. So plaudert Paul Pieterse jeweils nur kurz mit ihnen, um die vorhandene Beziehung zu bestätigen, sie aber nicht länger aufzuhalten.
Wir bitten auch die Besucher:innen des Goetheanum-Geländes, den Kühen achtsam zu begegnen, also sie nicht zu berühren oder gar zu streicheln und Hunde anzuleinen. Dies auch aus Sicherheitsgründen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ein Kochbuch für die Sinne
Buchvernissage
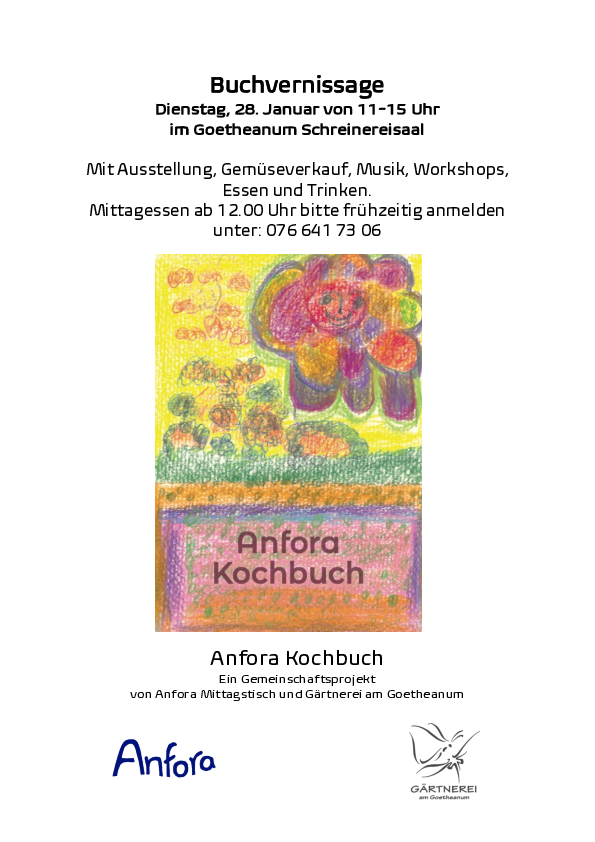

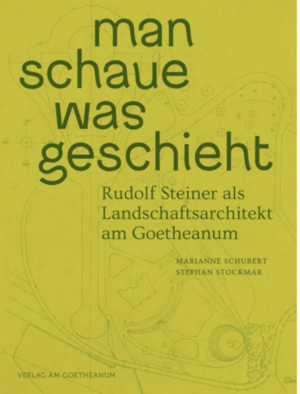
Projekt Quitte, Hasel, Walnuss
25.11.2024 | Heilpflanzen, Präparateforschung
Marianne Schubert & Torsten Arncken
Nach «man schaue was geschieht», dem Buch über Rudolf Steiners Landschaftsgestaltung am Goetheanum
(mit Stephan Stockmar als Co-Autor), entsteht nun ein weiteres Buch mit dem vorläufigen Arbeitstitel:
«Quitte, Hasel, Walnuss. Die ätherischen Hüllen der Goetheanum-Bauten»
Das Projekt braucht noch Unterstützung
Herbstzeit ist Erntezeit




Die Obstbäume rund um das Goetheanum hängen jetzt prallvoll mit Früchten. Ob Quitten, Äpfel oder Birnen – sie alle warten darauf, gepflückt und weiterverarbeitet zu werden. Da bekommt man Lust, als Besucher selbst Hand anzulegen und das Obst in mitgebrachte Taschen zu packen. Wir würden jedoch darum bitten, uns vorher zu kontaktieren. Einen Apfel zu pflücken und direkt zu essen, ist natürlich kein Problem, aber bei grösseren Mengen bitten wir um Zurückhaltung. Diese brauchen wir für die Herstellung unseres köstlichen Apfel-Birnen- und Apfel-Quitten-Mosts, den wir dienstags an unserem Marktstand verkaufen. Ähnliches gilt für die Nüsse.
Das Goetheanum ist in eine Obstwiese mit unzähligen Hochstammbäumen eingebettet, die Insekten und Vögeln Lebensraum bieten. Einige dieser Bäume wurden schon zu Rudolf Steiners Zeiten gepflanzt, andere sind später hinzugekommen oder wurden ersetzt. So finden sich heute Bäume in allen Altersstufen. Die Vielfalt der Obstsorten ist beeindruckend: Neben den erwähnten Äpfeln, Birnen und Quitten gibt es auch Kirschen, Zwetschgen, Mirabellen, Mispeln und sogar exotische Früchte wie Pfirsiche und Kakis. Auch Wild- und Zierobst wie Hagebutten, Weissdorn und verschiedene Schlehenarten bereichern den Park. «Besonders am Herzen liegen uns die alten Sorten, wie zum Beispiel der Bohnapfel», betont Rob Bürklin, Mitarbeiter der Gärtnerei am Goetheanum. Während der Grosshandel nur «perfektes» Obst bestimmter Sorten akzeptiert, pflegen wir hier die Sorten- und Geschmacksvielfalt. Wir ernten nicht nur, um Most herzustellen, sondern auch fürs Geschmackserlebnis.
Zu den (Obst-)Bäumen gehört natürlich auch das Herbstlaub, das dem Goetheanum-Park ein prächtiges Farbenspiel verleiht. Miranda Bossart, die unter anderem für die Pflege der Parkanlage zuständig ist, erklärt: «Wir entfernen das Laub von den Wegen, um Matsch und Unfälle zu vermeiden, aber auf den Wiesen lassen wir es liegen, denn das Laub liefert wertvolle Nährstoffe für die Bodenlebewesen.» Das gesammelte Laub wird zu Kompost verarbeitet, der insbesondere die Gemüsebeete bereichert. Darüber hinaus verwendet die Floristik das farbenprächtige Herbstlaub sowie das Wild- und Zierobst für ihre Kreationen.
Wir freuen uns, Sie bei einem Herbstspaziergang im Goetheanum-Gartenpark anzutreffen – und vielleicht geniessen Sie dabei ja auch einen unserer frischen Äpfel?
Unser neuer Päparatepavillon
Wer vom Hügelweg hoch zum Goetheanum kommt, dem leuchtet seit einigen Monaten ein imposanter Holzbau entgegen: der Rohbau des neuen Präparatepavillons. Die langen Balken des Vordachs schwingen sich zum Himmel empor, während der Pavillon selbst kompakt und geerdet wirkt. Die Architektur widerspiegelt die Bedeutung der Präparate: die Verbindung zwischen Kosmos und Erde, praktisch umgesetzt durch den Menschen.
Bereits vor 100 Jahren, als der Landwirtschaftliche Kurs als Grundlage der biodynamischen Landwirtschaft entstand, vergrub Rudolf Steiner mit Kuhmist gefüllte Hörner in Dornach. Allerdings nicht auf dem Goetheanum-Hügel, sondern in der Nähe des Sonnenhofs. Nun erhalten die biodynamischen Präparate dank des neuen Zuhauses einen frischen Impuls: Sie werden stärker sichtbar und erzeugen eine Ausstrahlung.
Kritiker:innen prangern die biodynamischen Präparate häufig als wirkungslosen esoterischen Hokuspokus an. Dieser Anschuldigung soll entgegengewirkt werden: Zum einen gibt es mittlerweile wissenschaftliche Studien, welche die Wirkungsweise der Präparate aufzeigen, zum anderen werden Besucher:innen des Goetheanums im Präparatehaus ausführlich über sie informiert. Ausserdem besteht der Wunsch, dass sich Interessierte stärker an der Herstellung und Ausbringung der Präparate beteiligen können. «Wir wollen Interessierte übers Tun abholen», sagen Kathrin Bürklin und Paul Pieterse, die Fachpersonen für Präparate am Goetheanum. Während Kathrin Bürklin den Anbau und Verkauf der Präparate koordiniert, ist Paul Pieterese für deren Herstellung verantwortlich.
«Präparate herzustellen ist aufwändig und nicht lukrativ», stellt Kathrin Bürklin fest, «aber es ist uns ein grosses Anliegen, sie hier am Goetheanum zu produzieren und für andere bereitzustellen, denn sie sind das Herzstück der biodynamischen Landwirtschaft.» Sowohl biodynamische Landwirt:innen als auch Hobbygärtner:innen bestellen die Präparate oder deren Bestandteile. Dazu zählen beispielsweise Hirschblasen, die von Jägern aus dem Kanton Graubünden zugeliefert werden.
Der neue Präparatepavillon dient insbesondere der Lagerung der Präparate. Eine Herausforderung dabei ist, dass die Luftfeuchtigkeit möglichst stabil bleibt. Zu starke Schwankungen schaden den Präparaten. Um dies zu gewährleisten, ist der Innenausbau sorgfältig zu planen. Bis wann dieser fertig sein wird und die Präparate ihr neues Zuhause beziehen können, ist noch unklar. Feststeht aber, dass mit dem neuen Impuls Veränderungen einhergehen: mehr Öffentlichkeit, eine stärkere Beteiligung von Interessierten an der Herstellung der Präparate und möglicherweise ein Anstieg der Nachfrage. Wir sind gespannt und freuen uns, euch den Einweihungstermin mitzuteilen, sobald dieser bekannt ist.
Winterlicher Blumenschmuck dank Trockenblumen
Das Besondere der Goetheanum-Floristik ist, dass der gesamte Prozess vom Samen bis zum fertigen Strauss vor Ort stattfindet und saisonal ist. Diese Konsequenz ist schweizweit nicht üblich, denn meist kaufen Floristikgeschäfte die Schnittblumen im Handel ein und bauen sie nicht selbst an.
So kommt es, dass sich die Florist:innen Lucinda Frei und Paul Saur bereits im vergangenen Frühling darüber Gedanken machten, welche Trockenblumen sie nun während der kalten Jahreszeit benötigen.
Nach der Anzucht im Frühjahr durften sie den richtigen Erntezeitpunkt für die jeweiligen Pflanzen nicht verpassen. Diese werden anschliessend sorgfältig getrocknet, damit später schönes Material mit leuchtenden Farben zur Verfügung steht. Nun, im grauen Winter, zaubern sie mit Strohblumen (Helichrysum), Strandflieder (Limonium), Kugelamarant (Gomphrena), Gräser, Mohnkapseln und weiteren Pflanzen einen abwechslungsreichen Blumenschmuck.
Seien Sie herzlich willkommen am Goetheanum und erfreuen Sie sich an den aktuellen floristischen Kreationen mit Trockenblumen!
Goetheanum-Gartenpark >>> Neue Beete für Färberpflanzen und Schnittblume

Goetheanum, Dornach, Schweiz, 20. Oktober 2023
Der Goetheanum-Gartenpark wird fortlaufend weiterentwickelt. Nun wurden die Themengärten ‹Färberpflanzen› und ‹Schnittblumen› verlegt und ein Teich angelegt. Bänke laden zum Verweilen ein – mit Sicht nach Basel und Frankreich.





